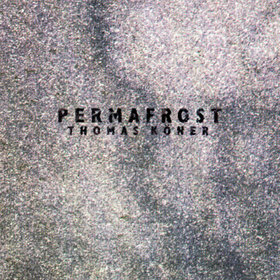Es ist das Jahr, in dem Fidel Castro auf Kuba die Macht übernimmt und damit den USA den bösen kommunistischen Feind vor die Tür setzt, in dem Alaska und Hawaii Bundesstaaten der Vereinigten Staaten werden. In diesem Jahr lehnen sich die Menschen in Tibet gegen die chinesische Bestzung auf, der Dalai Lama flieht ins indische Exil und das bisherige Staatsgebiet Tibet wird von China annektiert. US Präsident Richard Nixon und der russische KPdSU Parteichef Nikita Chruschtschow besuchen sich gegenseitig, um den kalten Krieg ein bisschen zu erwärmen. In Ruanda kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen den Volksgruppen der Hutu und Tutsi mit hunderten von Toten – ein Vorspiel zu den Massakern 35 Jahre später. In der Schweiz erhalten tatsächlich nun auch erstmals Frauen das Wahlrecht, die erste Barbie-Puppe kommt auf den Markt und in New York wird das Guggenheim-Museum eröffnet. Mit Buddy Holly, „The Big Bopper“ und Richie Valens sterben bei einem Flugzeugabsturz drei wichtige Protagonisten des Rock'n'Roll. Der Tag geht in die Geschichte ein als „the day the music died“. Und mit der Sängerin Billie Holiday und dem Saxophonisten Lester Young sterben zwei der einflussreichsten Jazzmusiker ihrer Zeit. Berry Gordy gründet das Soul-Label Motown Records. 1959 ist aber auch das Geburtsjahr von Morrissey, Susannah Hoffs (Bangles) und Sade Adu. In diesem Jahr mag Rock'n'Roll auf dem Rückzug sein – Elvis ist bei der Armee, seine Konkurrenten und Epigonen sterben oder werden weichgespült, dafür aber geht Jazz mit großen Schritten in eine revolutionäre Richtung – siehe Coleman, Mingus und Miles Davis, und einige der wichtigsten Alben des modernen Jazz werden veröffentlicht. Auch einige der alten Blues-Musiker machen sehr gute Alben, in der Countrymusik halten Musiker wie George Jones oder Marty Robbins einen hohen Standard, Nina Simone und Ella Fitzgerald machen tollen Vocal Jazz und der junge Ray Charles erfindet Soul. In NY treibt erstmals Dion mit seinen Belmonts sein Unwesen und der junge Blues-Forscher John Fahey macht (noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit) große Gitarrenmusik.
Miles Davis
Porgy and Bess
(Rec.
1958, Rel. 1959)
Miles Davis
Kind Of Blue
(Columbia,
1959)
Miles Davis Quintet
Workin' With the Miles Davis Quintet
(Prestige,
Rec. 1956, Rel. 1959)
1959 ist das Jahr, in dem Miles Davis' kommerziell und vielleicht auch künstlerisch bedeutendstes Album aufgenommen und veröffentlicht werden wird – Kind Of Blue transzendiert Jazz, mehr noch als John Coltrane's A Love Supreme – und erschließt ihn breiten Hörerschichten, die eigentlich mit Jazz Nichts anfangen können – aber dazu mehr weiter unten... denn zunächst beweist Davis mit seinem im Vorjahr in Zusammenarbeit mit Gil Evans eingespielten Album Porgy and Bess, dass er auf vielen Hochzeiten tanzen kann. Mit den Beschränkungen des BeBop unzufrieden und beeinflusst von einer Ballett-Aufführung seiner damaligen Freundin wollte er George Gershwin's von europäischer klassischer Musik beeinflusste Oper in Jazz übersetzen. Gil Evans hatte ihn schon beim '57er Album Miles Ahead auf die Möglichkeiten der Verbindung zwischen Orchester-Musik, Klassik und Jazz angefixt, die beiden kannten sich schon seit den 40ern, Evans hatte die 49er Aufnahmen zu Birth of the Cool arrangiert – und er würde mit Davis im folgenden Jahr die Sketches of Spain arrangieren. Welches dieser Alben nun das bessere ist, ist ein beliebte Frage unter Nerds – und so unerheblich wie die meisten solcher Fragen. Porgy and Bess ist Big Band-Sound in modern, Third Stream sagt man auch dazu, Davis Trompete übernimmt den prominenten Platz der Sänger/innen – mit Beredtheit und wunderbarer Coolness – Die Songs zu diesem Meisterwerk moderner amerikanischer Klassik sind sowieso über jeden Zweifel erhaben, Gershwin war ein Könner mit einem untrüglichen Gespür für ins Ohr gehende Melodien. Aber Davis und Evans übernehmen auch Gershwin's atonale Ausbrüche, das Orchster soll hier und da etwas steif geklungen haben – das mögen die Jazz-Kenner heraushören, mich ficht das nicht an, weil hier (für mich) Jazz, Klassik und Avantgarde die schönste Paarung ergeben. Müsste ich Tracks hervorheben, so wären das die Hits „Summertime“ und „It Ain't Necessarily So“ - aber das ist Rosinen-Pickerei. Big Band Sound ist das hier jedenfalls nicht – es ist ein weiteres Meisterwerk Miles Davis' – das wie gesagt gefolgt wurde von - Kind of Blue - welches aus zwei Gründen gerne als eine der wichtigsten Platten des Jazz bezeichnet: Zum Einen ist es bis heute das meistverkaufte – das heißt dann auch tatsächlich das „populärste“ - Jazz-Album aller Zeiten, aber vor Allem fallen auf diesem Album tatsächlich all die von Davis in den letzten Jahren zusammengesuchten Puzzleteile an ihren richtigen Platz. Dafür hatte Miles Davis im Frühjahr '59 zu den Sessions die besten Musiker des Jazz dieser Tage versammelt: John Coltrane, Bill Evans, Cannonball Adderley, Paul Chambers und Jimmy Cobb – die übrigens für ihre Dienste nach Tarif bezahlt wurden. Davis kam zu den Sessions, ohne die Stücke vorher mit seinen Musikern geprobt zu haben und setzte die Themen erst kurz bevor die Tapes zu rollen begannen - denn er verließ sich (zu Recht) darauf, dass seine Mitstreiter kongenial zu improvisieren vermochten. Eines der Geheimnisse dieses Albums dürfte sein, dass es hier nie so klingt, als wollten die Musiker sich gegenseitig die Show stehlen oder gar übertrumpfen. Der Hörer wird mit sanftem Piano und einer gediegenen Bassline bei „So What“ in das Album hinein gelockt, das Tempo wird nur noch minimal verändert, das relaxte Feeling hält sich über die ganze Albumlänge. Kind of Blue ist der Höhepunkt des modalen Jazz, bei dem die Improvisation minimalistisch ist, die Musiker ruhig, manchmal fast wie in Meditation versunken klingen, ohne dabei aber die Spannung zu verlieren. So ist Kind of Blue wohl aufgrund seiner Ruhe und Schönheit - unabhängig von aller Theorie - mehr als „nur“ Jazz, es ist einer der Höhepunkte der Musik des 20. Jahrhunderts – über alle Genre-Grenzen hinweg. Da dürfte dann im Vergleich die Resteverwertung des Prestige-Labels unter dem Titel Workin' With the Miles Davis Quintet dem Kenner fast enttäuschend erschienen sein. Na ja, das Album wurde im Dezember '59 zum Weihnachts-Geschäft veröffentlicht, es ist ein weiteres Ergebnis der legendären Sessions an zwei Tagen Ende Oktober 1956, die Vertrags-Erfüllung, damit Davis damals zu Columbia wechseln durfte – aber nach unwillig geleisteter Arbeit klingt das auch nicht. Workin... ist von den vier Ergebnissen dieser Sessions (Relaxin'..., Steamin'..., Cookin'... und eben dieses hier) vielleicht das „freundlichste“. Was sicher am Opening Track „It Never Entered My Mind“ liegt, eines der wärmsten und liebevollsten Stücke, die Davis je gespielt haben wird. Auch Pianist Red Garland berührt die Tasten meist mit Samt-Handschuhen, aber auch bei „härteren“ Tracks wie „Four“ oder „Ahmad's Blues“ herrscht eine Leichtigkeit, die nach guter Laune klingt. Die Tatsache, dass John Coltrane (der hier Saxophon spielte) noch nicht als der ganz große Solist zu erkennen ist, mag auch mit Davis' Ego zu tun gehabt haben. Immerhin wären sicher hunderte von Jazzern dieser Zeit froh gewesen, solches Material auf die Welt loslassen zu können. Und dennoch: Nur die beiden anderen '59er Miles Davis Alben sind unverzichtbar.
Ornette Coleman
The Shape Of Jazz To Come
(Atlantic,
1959)
The Shape of Jazz to Come wurde genau wie John Coltranes erstes Solo-Album Giant Steps im Mai 1959 aufgenommen, aber im Gegensatz zu diesem auch 1959 – auch auf Atlantic - veröffentlicht (Verstehe einer die damalige Veröffentlichungspolitik der Labels). Jedenfalls war der Titel des zweiten Solo-Albums von Ornette Coleman durchaus als Provokation zu verstehen. The Shape Of Jazz To Come kann mit Fug und Recht als Erste Free-Jazz LP bezeichnet werden. Coleman war zu dieser Zeit mit seiner Verweigerung gegenüber den geläufigen formalen Vorgaben des Jazz – und aufgrund seines Verzichtes auf einen Pianisten - revolutionärer, als sich das heute anhören mag. Auf The Shape of Jazz to Come ist im Grunde noch alles melodisch, die Rhytmen sind nachvollziehbar, die Musiker folgen durchaus gemeinsam den Themen, aber hier wurde erstmals – und zwar bewußt – auf konventionelle Harmoniewechsel verzichtet – und damit die gerade neu geschaffenen Regeln des Modal Jazz gebrochen und hier hielt kein Klavier die Musik zusammen. Die Soli klingen dadurch frei, die Solisten wollen und sollen Gefühlen nachspüren statt instrumentale Finesse zu präsentieren, sie laufen auseinander, finden aber immer wieder zusammen. Coleman hatte mit Trompeter Don Cherry, Bassist Charlie Haden und Drummer Billy Higgins das perfekte Personal gefunden, - eines, das vielleicht – genau wie er – nicht technisch so versiert war wie andere Zeitgenossen, dafür aber seiner „emotionalen“ Herangehensweise folgen konnte und ihm in noch viel „freiere“ Bereiche folgen würde. Die Reaktionen auf diese LP waren seinerzeit extrem, Coleman war als radikaler Verweigerer berüchtigt, und wurde wegen seiner vergleichsweise geringeren Virtuosität verachtet - um so seltsamer, wenn man heute Tracks wie das wunderbare „Lonely Woman“ oder das gefühlvolle „Peace“ oder das organisierte Chaos von „Eventually“ hört. Mit diesem Album beginnt die Jazz-Avantgarde.
Charlie Mingus
Mingus Ah Um
(Columbia,
1959)
Charles Mingus' Debüt für Columbia, Mingus Ah Um ist so etwas wie eine Zusammenfassung all seiner Talente und eines der besten Alben, um in seine Musik hineinzufinden - auch für Hörer, die sich sonst kaum an Jazz heranwagen. Ah Um ist sofort zugänglich und es sind ein paar von Mingus besten Songs/Kompositionen darauf enthalten, Songs, auf denen er sein Können als Arrangeur und Motivator beweist. Er hatte für die Sessions zu diesem Album eine erprobte Band aus Musikern, die ihn kannten, die die Mischung aus Improvisationsfreude und Unterordnung unter den „Sinn“ seiner Kompositionen und Strukturen garantierten. Da waren die Saxophonisten John Handy, Shafi Hadi und Booker Ervin, die Trombonisten Jimmy Knepper und Willie Dennis, der Pianist Horace Parlan und der Drummer Dannie Richmond ... aber die Namen sind egal – was hier zählt ist das Team – und die Songs, von denen mindestens drei sofort zu Standards wurden (das ist Jazz' für „Hit“). Es beginnt mit dem spiritual-artigen „Better Get It in Your Soul“, in rasantem 6/8 Rhythmus, punktiert von begeisterten Gospel Shouts. „Goodbye Pork Pie Hat“ ist eine langsame und würdevolle Elegie für den großen (kurz zuvor verstorbenen) Saxophonisten Lester Young. Und dann ist da natürlich das höhnische „Fables of Faubus“ - ein Song der (nicht zum letzten Mal) Mingus' deutliches politische Engagement in musikalische Form gießt. Es geht um den Gouverneur von Arkansas, der als strikter Verfechter der Rassentrennung hier den Spott und die Wut der versammelten Mannschaft auf sich zieht. Es ist schon faszinierend, wie stark diese Emotionen in der (übrigens ursprünglich NICHT rein instrumentalen) Musik zur Geltung kommen. Die Texte wurden für das Album tatsächlich von feigen Plattenfirmen-Angestellten gestrichen. Und die restlichen Songs: Aggressiver Swing bei „Boogie Stop Shuffle“, das Ellington-Tribut „Open Letter to Duke“ oder etwa das sanfte „Self-Portrait in Three Colors“ sind genauso unterhaltsam. Mingus Ah Um bietet tatsächlich Musik einer „Big Band“ (im wörtlichen Sinne), die ich toll finden kann, ohne diese Art von Jazz wirklich analysieren zu wollen/müssen.
Dave Brubeck
Time Out
(Columbia,
1959)
Dave Brubeck's Time Out ist vermutlich von den Verkaufszahlen her ähnlich erfolgreich wie Miles Davis' Kind of Blue. Und es ist ein weiteres der Art, die sowohl Jazz-Fans als auch solche, die selten Jazz hören, in ihrer Playlist haben. Und dabei ist Time Out auf musik-theoretischer Seite weit experimenteller als Kind of Blue. Mit diesem Album wurde es tatsächlich fertiggebracht, einen Umbruch im Jazz so angenehm zu verpacken, dass man nur, wenn man genau hinhört (oder versucht den Takt mitzuzählen), die Komplexität der Musik erkennt. Time Out ist ein Album voller cleverer und teuflisch schwer zu spielender Musik, in der bewusst „ungerade“ Rhythmen mit Strukturen aus Klassik und Jazz.verquickt werden. Pianist und Komponist Dave Brubeck's Crew - bestehend aus Paul Desmond (sax), Eugene Wright (b) und Joe Morello (dr) - hatte sich vorgenommen, alle bekannten und üblichen Taktarten bewusst außer Acht zu lassen (daher auch der Titel des Albums: Taktarten = Time Signatures). Dass die Kompositionen dabei aber genauso bewusst melodisch angenehm bleiben sollte, ist wohl der Grund für den Crossover-Erfolg des Albums – und der Grund dafür, dass Jazz -Snob's das Album bis heute gerne verächtlich betrachten. Mir egal: Stücke wie „Blue Rondo A La Turk“ (im 9/8tel Takt) und vor Allem das weltbekannte „Take Five“ (im 5/4tel Takt) sind in meinen Ohren schlicht cool. Tatsächlich spielt hier der Begriff Cool Jazz eine große Rolle: Keine wahnwitzigen Soli sondern Atmosphäre und intelligentes Miteinander sind am wichtigsten. Time Out ist als komplettes Album vor Allem rhythmisch revolutionär. Dave Brubeck wollte damit vielleicht keine Grenzen niederbrechen, wie Ornette Coleman es mit seinem Ausruf „Free Jazz!“ spätestens in einem Jahr machen wollte – er wollte einen Teilbereich des Jazz erweitern, ohne das Publikum dabei zu verschrecken... auch ehrenwert. Ach ja – der Cover-Designer von Time Out und Mingus Ah Um (Neil Fujita) hatte '59 viel zu tun...
Art Blakey & the Jazz Messengers
s/t (Moanin')
(Blue
Note, 1959)
Während die meisten anderen hier vorgestellten und empfohlenen Jazz-Alben des Jahres '59 entweder bewusst oder unfreiwillig revolutionär waren, ist es auch mal erfreulich, eine wirklich gelungene Platte zu hören, die ganz den Stil ihrer Zeit einfängt: Hard Bop in perfekte Form gegossen. Der Drummer Art Blakey hatte mit seinen Jazz Messengers schon Mitte der Fünfziger eine der Kaderschmieden des modernen Jazz geleitet, aber Drogen hatten die Band implodieren lassen. 1958 kam dann der Saxophonist Benny Golson neu in die Band und drehte Alles auf Links. Mit neuen Musikern – dem Trompeter Lee Morgan, dem Bassisten Jymie Merritt und dem Pianisten Bobby Timmons und vor Allem mit einigen tollen Songs hauchte er den Messengers neuen Atem ein. Zwar sollte Golson die Band bald wieder verlassen (weil er Blakey zu dominant wurde) aber das Album Art Blakey & The Jazz Messengers, das erst später wegen des gleichnamigen Songs in Moanin' umbenannt wurde, ist eines der Standardwerke das Jazz. Wegen des Titelstückes (wenn du es hörst, wirst du es kennen), wegen des New Orleans-Marsches „Blues March“ - auch bald ein Standard - und einfach weil hier eine hervorragend spielende Band echten Spaß an ihrer Kraft und Virtuosität hat, und dazu auch noch etwas zu sagen hat. Jazz mit mehr als nur akademischen Interessen, mit der Inspiration, die ich persönlich auf Jazz-Alben mehr achte, als technische Finesse. Für den Veteranen Blakey – dessen polyrhythmisches, afrikanisch angehauchtes Spiel in der drei-teiligen „Drum Thunder Suite“ ganz virtuos und klassisch zur Schau gestellt wird – wurde dieses Album zum Neu-Start seiner Karriere.
Nina Simone
The Amazing Nina Simone
(Colpix,
1959)
Weil diese Hauptartikel immer auch ein Querschnitt durch dem stilistischen Kuchen des jeweiligen Jahres darstellt, musste ich mich auch für '59 entscheiden, welches Vocal-Jazz Album ich exponieren würde. Und da gab es ein paar Kandidaten: Ella Fitzgerald's Sings the George and Ira Gershwin Songbook ist große Kunst, Bobby Darin's That's All ebenfalls, genau wie die anderen, im entsprechenden Artikel Vocal-Jazz 1959 gelobten Alben. Aber ich wollte unbedingt Nina Simone in einem Hauptartikel unterbringen – weil sie bis heute eine der eigenständigsten, stilprägendsten, großartigsten Sängerinnen aller Zeiten geblieben ist. Weil ihr eigenartiger, rauer und kehlige Alt unnachahmlich geblieben ist. Und weil sie als Persönlichkeit extrem spannend war. Nina Simone kam 1933 als Eunice Kathleen Waymon auf diese Welt, sie wollte zunächst Konzert-Pianistin werden, hatte eine erfolgreiche Audition auf der Musik-Hochschule in Philadelphia, wurde aber wegen ihrer Hautfarbe abgelehnt. Um Geld zu verdienen spielte se in Jazz-Clubs, wo man ihr erklärte, sie müsse zum Piano auch singen. Und so begann eine Karriere, die bis in die Siebziger etliche bedeutende Alben (… das, was mich hier interessiert...) hervorbrachte. Schon im Vorjahr hatte sie einen Charts-Hit mit Gershwin's „I Loves You, Porgy“, Das dazugehörige Album Little Girl Blue zeigte sie als Pianistin von großer Klasse und als Interpretin mit eigenem Stil (Und es enthält „My Baby Just Cares for Me“...). Wie sollte es mit dieser Stimme auch anders sein. Mit der Unterstützung des Labels unzufrieden, wechselte sie zu Colpix und nahm mit dem von den Elvis-Komponisten Leiber und Stoller bekannten Produzenten und Arrangeur Bob Mersey ein Album von erstaunlicher stilistischer Bandbreite auf. Ihr Klavierspiel steht hier nicht im Vordergrund, ihre Stimme und ihre Phrasierung wird mal mit kleiner Besetzung, mal von kraftvollen Bläsern oder süßlichen Orchesterklängen untermalt. Da gibt es das hoch-emotionale „It Might AsWell Be Spring“, direkt ein Klassiker, genau wie das swingend/jazzige „Can't Get Out of This Mood“, das wütende „You've Been Gone Too Long“, bei dem der Typ, der zu lange wegblieb mir ein bisschen leid tut. Großartig auch das (auf dem Mississippi) treibende „Chilly Winds Don't Blow“ - fast schon Soul oder die englische Folk-Ballade „Tomorrow (We Will Meet Once More)“. Keine geringe Leistung, dass all das zusammenhält. Manchem mag das etwas einheitlichere Debüt besser gefallen – ich mag dieses Album allein schon deshalb, weil es meine erste Simone-Album war. Und da kommen noch etliche weitere sehr gelungene Alben: Pastel Blues und Wild is the Wind von '65 und '66 sind Pflicht – und zeigen eine Künstlerin, die sich auch politisch stark engagierte....
Lightnin‘ Hopkins
The Roots of Lightnin‘ Hopkins
(Smithsonian,
Folkways, 1959)
Den Blues hatte der 1912 geborene Lightnin' Hopkins bei Blind Lemon Jefferson gelernt (Den Beinamen „Lightnin' bekam er als er 1946 mit dem Pianisten „Thunder“ Smith Aufnahmen machte) und in den Jahren bis 1959 hatte er nur hier und da Plattenaufnahmen – üblicherweise 7''es - gemacht. Aber dann wurde er vom Blues-Forscher Sam Charters nach einigem Suchen in einem Ein-Raum Appartement in Houston gefunden (Zu dieser Zeit haben sich etliche junge weiße Amerikaner auf die Suche nach alten Blues-Männern gemacht). Charters kam, sah und konnte ihn mit Hilfe einer Flasche Gin überreden in seinem Zimmer diese zehn Songs mit Hopkins' aus dem Pfandhaus ausgelösten Gitarre und nur einem Mikrofon aufzunehmen. Das tat der Qualität der Songs keinen Abbruch, im Gegenteil, das Resultat waren auf's wesentliche reduzierte, ja regelrecht skelettierte, in ihrer Verzweiflung gespenstische und dadurch ungemein intensive Songs. Dass er Blind Lemon Jefferson's „see That My Grave is Kept clean“ coverte, dass er den Traditional „Penitentiary Blues“ spielte und in seine Welt holte, zeugt von seinem Selbstbewusstsein - eigene Songs hatte er schließlich genug. Und auch bei sparsam dargebotenen Tracks wie „Come and Go With Me“ kann man sich vorstellen, wie sehr er in wenigen Jahren junge weisse Musiker im UK beeindrucken und beeinflussen würde. Durch die einfachen Aufnahme-Methode klingt The Roots... natürlich zeitlos – hätte auch gestern entstehen können, Hopkins würde allerdings nie mehr so reduziert klingen, dies war die Essenz seiner Musik und hier begann sein persönlicher Anteil am Blues-Boom der 60er – den er bis in die Siebziger mit unzähligen eigenen Alben belieferte.
Ricky Nelson
Ricky Sings Again
(Imperial,
1959)
Ricky Nelson
Songs by Ricky
(Imperial,
1959)
Die „Pop“ Musik Ende der Fünfziger/ Anfang der Sechziger gilt als schwachbrüstig, harmlos und konformistisch – was der Tatsache geschuldet ist, dass die Protagonisten des Rock'n'Roll entweder tot, im Gefängnis oder musikalisch zumindest scheintot waren, die kurze „Revolution“ durch Rebellen wie Elvis, Gene Vincent, Buddy Holly oder Eddie Cochran scheinbar abgeflaut war. Musiker wie Sinatra triumphierten und der weit mehr im Mainstream verwurzelte, gerade 19-jährige Ricky Nelson bekam mit seiner scheinbar weichgespülten Version von Rock'n'Roll ein breites Publikum. Nelson aber beabsichtigte nicht, in seichten Gewässern dahin zu dümpeln, schnell bekam seine Musik erstaunliche Tiefe, mag sein, dass der Umstand, dass seine Begleiter aus der Creme de la Creme der Studiomusiker seiner Zeit bestand eine Rolle spielte – zumal seine Songs von den ganz Großen der Szene tatsächlich für ihn geschrieben wurden. Es dürfte aber auch so sein, dass sich das Talent des hier gerade mal 18-jährigen nicht verleugnen ließ. Sein Gesang auf diesem dritten Album ist selbstbewusst, man hört, dass er gehörig Live-Erfahrung gesammelt hatte. Natürlich lehnt er sich an Elvis an, aber er kennt auch die Everly Brothers, er hatte sich mit den Songwritern Dorsey und Johnny Burnette (die 1956 selber das phänomenale Album Johnny Burnette & The Rock’n’ Roll Trio veröffentlicht hatten) eingelassen, die ihm im Vorjahr den Hit „Believe What You Say“ beschert hatten. Hier sind die ersten drei Songs von ihnen und „It's Late“ wird auch zum Hit. Und er bedient – wie Elvis – auch die Balladen-Abteilung: Mit „Lonesome Town“ war er auch in diesem Metier erfolgreich. Das Hank Williams' Cover „I Can't Help It (If I'm Still in Love With You)“ wiederum bedient die Everly's-Fangruppe - all das zeigt, dass er sich ein bisschen zwischen den Stühlen aufhielt: Nicht Rock'n'Roll, noch nicht richtig Country – auch wenn er ganz schön Johnny Cash's „Restless Kid“ interpretiert - aber immer geschmackvoll und seinerzeit immens populär. Klar, dass nicht einmal neun Monate vergehen, ehe das nächste Album auf den Markt geworfen wird. Zeit für echte Weiterentwicklung war da wohl nicht – aber immerhin war Nelson jetzt 19, seine Band war eingespielt, mit Gitarrist James Burton, Pianist Gene Garf, Bassist James Kirkland und Drummer Richie Frost standen Könner hinter ihm, die ihn über Jahre begleiten würden. Dazu kommt Elvis' Background Chor The Jordanaires – somit alles in trockenen Tüchern. Und dazu natürlich wieder Songs der Burnette-Brüder - J. Burnette's „Just a Little Too Much“ wird wieder zum Hit, genau wie Baker Knight's „Sweeter Than You“. Der Titel Songs By Ricky mag da irritieren – aber immerhin ist Nelson's Stimme und der Sound seiner Band charakteristisch – und auch wenn dieses Album nicht den Erfolg und die Bekanntheit von Ricky Sings Again hat – es ist nicht schlechter, sondern einfach eine Ergänzung, die mit ihrer Spielzeit von 26 Minuten als B-Seite zu den 25 Minuten des Vorgängers stehen mag.
Dion & The Belmonts
Presenting Dion and the Belmonts
(Laurie,
1959)
Es ist in der Rückschau kaum vorstellbar – aber Rock'n'Roll war Ende der Fünfziger eher eine Randerscheinung, eine Art von Musik, die belächelt und als vorübergehende Torheit der Jugend betrachtet wurde. Klar, Elvis war ein Star, seine Alben Hits, aber er war zum Militärdienst einberufen worden und würde da schon Disziplin lernen. Andere Rock'n'Roller starben am „Day the Music Died“, oder sie hatten sich als die Verbrecher entpuppt, die der anständige Teil der Bevölkerung immer hinter ihnen vermutet hatte. Ihr musikalischer Output bestand aus ein paar Singles, die bald vergessen schienen und den Compilations, die ich hier als Grundlagen der Rockmusik präsentiere – die aber eigentlich doch nur Resteverwertung sind. Aber da gibt es auch das Debüt der New Yorker Doo Wop Meister Dion & the Belmonts, und das funktioniert tatsächlich als komplettes Album – nicht als Zusammenstellung bloßer Hits. Auch noch in einem obskuren Genre, in dem komplette Alben gleichbleibend hoher Qualität quasi nicht existieren. Doo Wop ist eine Form des R&B, in der mehrstimmiger Gesang mit rhythmisch unterlegten Vocals als Ersatz für Instrumente neben der Lead-Stimme zu rasantem Pop wird. Man muss sich das tatsächlich so vorstellen, dass die Jugendlichen in den finstereren Teilen der US-Großstädte an Straßenecken zusammenstanden und in Ermanglung solcher Dinge wie Ghetto-Blaster o.ä. gemeinsam sangen. Da gab es schon zu Beginn der Fünfziger Bands wie The Orioles, The Flamingos, da gab es The Ravens und The Larks aus NY, oder The Robins aus San Francisco, die bald zu den Coasters wurden. Eines der Star-Ensembles des Doo Wop waren die New Yorker The Belmonts mit ihrem Lead-Sänger und Songwriter Dion DiMucci. Mit dem virtuosen „I Wonder Why“ hatten sie einen ersten Hit, der sie auch über die Grenzen des Big Apple berühmt machte. Sie waren bei der schicksalshaften Tour mit Buddy Holly, Ritchie Valens und The Big Bopper dabei - aber Dion stieg nicht ins Flugzeug und entkam so dem fatalen Absturz. Bald kam mit „A Teenager in Love“ der nächste Hit, und die vier Musiker nahmen die restlichen Titel für ein komplettes erstes Album auf. Und das ist dann das wirklich Schöne an Presenting Dion and the Belmonts. Das Album hat als Ganzes seine Daseinsberechtigung – die Hits sind natürlich dabei, aber der gelinde Country Sound bei „You Better Not Do That“ oder das programmatische „I Got the Blues“ können locker mithalten. Natürlich geht es immer um Mädchen – aber dieses ewig-junge Thema wird enorm facettenreich behandelt, die Gesangsleistungen sind erstaunlich – insbesondere nach heutigen Maßstäben – und Dion erwies sich als Teenage-Star mit Niveau und Tiefe (und einer reichen, wenn auch durch Drogen und kommerzielle Tiefs unterbrochenen Karriere). Er ist derjenige, der New York auf die Landkarte des Rock'n'Roll brachte, dieses Album ist die Entdeckung wert.
Marty Robbins
Gunfighter Ballads & Trail Songs
(Columbia,
1959)